Der Oxford OSCar Synthesizer(1983–ca. 1987) verbindet superstabile analoge DCO-Sounds mit digitalen Extras wie additiver Synthese, Speicherplätzen und Sequencer. Ungewöhnliches Design, mächtiges Multimode-Filter mit Separation-Regler und dreckiger Drive – aber eine eingewöhnungsbedürftige Bedienung und frühe MIDI-Schwächen. Klingt groß, ist selten, Software-Alternative verfügbar.
Kontext: Analoger Außenseiter in der Digitalwende
1983 läutet Yamahas DX7 die FM-Revolution ein, MIDI setzt sich durch – und ausgerechnet jetzt bringt die Oxford Synthesizer Company (OSC) von Chris Huggett mit dem OSCar einen analogen Synthesizer mit digitalen Raffinessen. Das Ergebnis ist ein eigenständiger Hybrid, der bis etwa 1987 gebaut wurde und heute Kultstatus genießt.
Entstehung & Historie des Oxford OSCar
Chris Huggett war kein Unbekannter: Mit Electronic Dream Plant (EDP) verantwortete er den Wasp, den Gnat und den Spider-Sequencer. Nach dem Aus von EDP im Jahr 1981 gründete er – unterstützt von seinen Eltern – die Oxford Synthesizer Company. Der OSCar blieb ihr einziges Produkt. In Deutschland lag der Neupreis bei rund 2.500 DM.
Oxford OSCar: Design & Bedienung
Der OSCar fällt sofort durch seine weichen Seitenteile und die gepolsterten Inlays auf – ein Look, der nicht nur eigenwillig wirkt, sondern die dicht gepackte Elektronik und die Regler beim Transport tatsächlich schützt. Das dreioctavige Keyboard ist ungewichtet und reagiert nicht auf Anschlagdynamik, übernimmt aber eine zweite Rolle als multifunktionales Bedienfeld: Viele Parameter sind über Doppelfunktionen erreichbar. Da ein Display fehlt, geben LED-Kombinationen den Betriebsstatus wieder – ohne Handbuch geht es anfangs also kaum. Als Spielhilfen stehen Pitch- und Modulationsrad mit Rückholfeder bereit, dazu Portamento und Glissando.
Anschlüsse & MIDI
Ungewöhnlich ist die Platzierung der meisten Anschlüsse auf der linken Seite: Hier finden sich Audio-Ausgang, ein Eingang zur externen Signalbearbeitung, das Kassetten-Interface und der Trigger-Eingang, während die MIDI-Buchsen (In/Out/Thru) klassisch hinten sitzen. Die ersten rund 250 Geräte wurden noch ohne MIDI ausgeliefert; später kam eine Implementierung hinzu, deren Geschwindigkeit und Timing anfangs eher behäbig wirkten. Mit höherem Betriebssystem – zuletzt Version 7 – verbessert sich die Genauigkeit spürbar. Die finale MIDI-Firmware „M2“ ermöglicht zudem SysEx-Transfers von Sounds. Wer absolut tight spielen möchte, programmiert Sequenzen am besten intern und synchronisiert sie über den Trigger-Eingang, denn das arbeitet oft präziser als externes MIDI.
Sequencer & Arpeggiator
Der interne Sequencer bietet zwölf Speicherplätze und fasst etwa 1.500 Noten. In der Praxis überzeugt er vor allem durch sein Timing, insbesondere wenn er via Trigger-Eingang zu Drum-Maschinen oder externen Clocks synchronisiert wird. Der Arpeggiator ergänzt das Setup für spontane Pattern und rhythmische Texturen – gerade in Kombination mit dem Drive des Filters werden daraus schnell bissige Bassläufe und perkussive Leads.
Klangerzeugung: DCO-Kern plus digitale Extras
Zwei digital gesteuerte, sehr stimmstabile Oszillatoren bilden das Herz des OSCar und lassen sich mono oder duophon spielen; im zweistimmigen Modus steht jeder Stimme ein Oszillator zur Verfügung – ähnlich wie beim ARP Odyssey. Die klassischen Wellenformen Sägezahn, Rechteck, Puls (fix oder moduliert) und Dreieck werden durch eine Besonderheit ergänzt: Fünf digitale Wellen liegen als Presets vor, weitere fünf können per additiver Synthese erstellt werden. Bis zu 24 Harmonische lassen sich dabei direkt über die Tastatur in ihrem Pegel setzen – eine mühsame Prozedur ohne Display, klanglich aber äußerst ergiebig. Für Schwebungen sorgt eine ausgefuchste PWM-Architektur: Jeder DCO besitzt einen eigenen, tastaturpositionsabhängigen LFO, dessen minimal unterschiedliche Geschwindigkeiten besonders breite Puls-Sounds ermöglichen.

Filter & Modulation: Der „Separation“-Trumpf
Das Multimode-Filter arbeitet als Tief-, Band- oder Hochpass und besteht aus zwei 12-dB-Sektionen, die sich seriell oder parallel verschalten lassen; in Low- und High-Pass-Konfiguration sind so 24 dB pro Oktave möglich, während der Bandpass stets zweipolig bleibt. Der Clou ist der Separation-Regler: Er legt die Cutoff-Frequenzen der beiden Filter auseinander, sodass bei hohen Resonanzwerten zwei eigenständige Peaks entstehen – ideal für formantartige, bissige Spektren. Ein integrierter Drive hebt das gefilterte Signal in die Sättigung und erweitert den Charakter von warm bis rau. Zwei ADSR-Hüllkurven (für VCA und VCF) inklusive mehrerer Trigger-Modi samt Auto-Repeat sowie ein LFO mit Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Random und verzögertem Anlauf runden die Modulationsabteilung ab.
Oxford OSCar Sound & Praxis
Klanglich spielt der OSCar über seine Größe hinaus. Er liefert mit leichter Hand autoritäre Bässe und prägnante Sequencer-Lines, während Leads dank PWM-Breite und Drive schnell zu schneidenden Solostimmen werden. Gleichzeitig beherrscht er subtile, lebendige Analogtexturen und erweitert sein Spektrum durch die additiven Wellen um glasige, digitale Schimmer – in der Anmutung teils an Kawai K5 erinnernd. Das Filter prägt den Grundcharakter maßgeblich; die Separation-Funktion ermöglicht dabei tiefgreifende, musikalische Eingriffe ins Frequenzbild. Einzig die Einarbeitung in das LED- und Doppelfunktions-Konzept trübt den Einstieg ein wenig, wird mit wachsender Routine aber zur Nebensache.
Prominente Nutzer & Tracks
Zu den Artists, die den OSCar eingesetzt haben, zählen Keyboard-Größen wie Keith Emerson, Jean-Michel Jarre („Industrial Revolutions“) und Stevie Wonder („Keletons“) sowie Bands wie Ultravox („Love’s Great Adventure“) und Front Line Assembly. In den 90ern prägte der OSCar Produktionen von Future Sound of London, Orbital, Underworld und den Sneaker Pimps. Die ikonische Bassline von „Theme Of S-Express“ stammt von einem OSCar; in Deutschland findet sich das Techno-Duo Hardfloor unter den bekanntesten Nutzern.
Kauf & Alternativen
Auf dem hiesigen Gebrauchtmarkt taucht der OSCar nur selten auf; mit etwas Glück wird man auf britischen Plattformen fündig. Die Hardware kann altersbedingt zickig sein und ist nicht die servicestärkste – wer eine entspannte Lösung sucht, greift zur Software-Umsetzung von GForce/M-Audio. Die Emulation kommt dem Original besonders bei additiven Klängen sehr nahe, bietet obendrein Polyphonie und eine integrierte Effektsektion – eine realistische Alternative, wenn Authentizität und Alltagstauglichkeit gleichermaßen zählen.
Pro & Contra
Pluspunkte
- Stabile DCOs mit analogem Punch
- Additive Wellen: einzigartiges Spektrum
- Multimode-Filter mit Separation + Drive
- Arp & Sequencer mit tightem Trigger-Sync
- Speicherbare Sounds
Minuspunkte
- Bedienung ohne Display: Lernkurve
- Frühe MIDI-Implementierung: zähes Timing
- Selten und teils serviceanfällig
- 3-Oktaven-Keyboard ohne Velocity/Aftertouch
Oxford OSCar Technische Daten (Kurzüberblick)
- Baujahre: 1983–ca. 1987
- Stimmen/Modi: mono, duophon (pro Stimme 1 DCO)
- Oszillatoren: 2× DCO (Saw, Square, Pulse/PWM, Triangle)
- Digitale Wellen: 5 Presets + 5 User (additiv bis 24 Partials)
- LFOs: 1 globaler LFO (Tri, Saw, Square, Random, Delay); je DCO PWM-LFO (tastaturpositionsabhängig)
- Filter: Multimode (LP/BP/HP), 2×12 dB seriell/parallel (LP/HP bis 24 dB), Separation, Drive
- Envelopes: 2× ADSR (VCA/VCF), mehrere Trigger-Modi, Auto-Repeat
- Speicher: Patches + Sequencer (12 Pattern, ~1.500 Noten)
- Sync: Trigger-In, Arpeggiator, interner Sequencer
- MIDI: In/Out/Thru; frühe Geräte ohne; OS bis v7, MIDI-FW „M2“ (SysEx)
- Anschlüsse: Audio Out, Audio-In (External Process), Trigger-In, Tape I/O (links); MIDI hinten
- Keyboard: 3 Oktaven, ungewichtet, keine Velocity
FAQ
Ist der OSCar analog oder digital?
Hybrid: analoge DCO-Oszillatoren plus digitale Wellen/additive Synthese und digital gesteuerte Funktionen.
Wie klingt der OSCar?
Von fetten Bässen und sequenzierten Acid-Lines bis zu schneidenden Leads und formantigen Filterfahrten; dank additiver Wellen auch glasige Digitalschimmer.
Wie tight ist das Timing?
Externes MIDI kann träge wirken. Für den straffsten Groove Sequenzen intern programmieren bzw. über den Trigger-Eingang synchronisieren.
Gibt es eine Software-Version?
Ja: GForce/M-Audio OSCar – sehr nahe am Original, polyphon, mit Effekten.
Oxford OSCar: Fazit
Der Oxford OSCar ist ein charakterstarker Hybrid: analoger Kern, digitale Raffinesse und ein Filter mit echtem Alleinstellungsmerkmal. Wer den Bedien-Eigenheiten eine Chance gibt, wird mit ikonischen Bässen, griffigen Leads und ungewöhnlichen Formant-Texturen belohnt. Auf dem Gebrauchtmarkt rar – als Plugin aber eine realistische Alternative.

Auch interessant:
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast




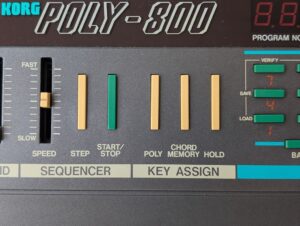





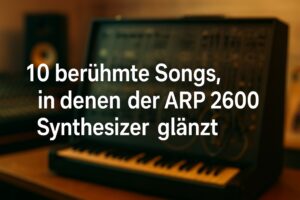








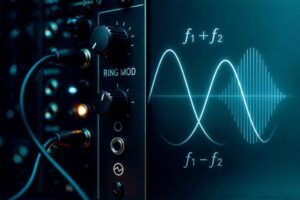
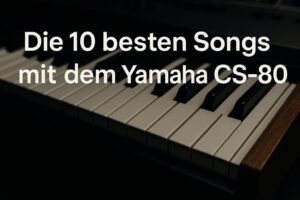






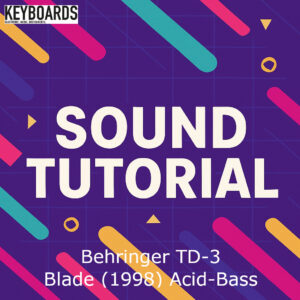











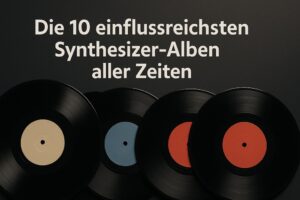
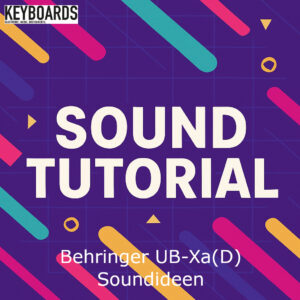






Unsere neuesten Beiträge
Pitchbend-Wheel am Synthesizer oder Keyboard
Pitchbend-Rad am Synthesizer: Ausdruck, Feeling und Kontrolle – so nutzt du das Wheel richtig Wer [...]
> WEITERLESENVoyetra Eight (1983), analoger Synthesizer
Voyetra Eight (1983): Der unterschätzte Analog-Rack-Synthesizer mit Sequencer, Arpeggiator und Modulationsmatrix Obwohl er nie im [...]
> WEITERLESENTutorial: Songwriting-Routinen und Recording-Gewohnheiten
Ein neues Jahr fühlt sich oft wie ein leerer Notizblock an. Voller Möglichkeiten für neue [...]
> WEITERLESEN